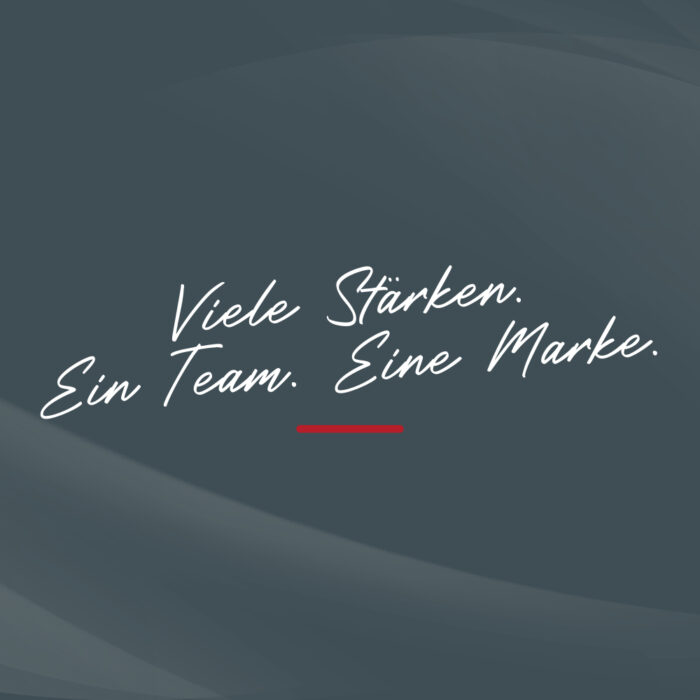Der Immobilienmarkt im Frühjahr 2024 – ein Stimmungsbild
Die Stimmung steigt. Das Immobilienklima hellt auf. Das belegt mit einem Wert von 1,0 Punkten im ersten Quartal 2024 auch der Immobilienstimmungsindex (ISI) des Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA) sowie des Instituts...