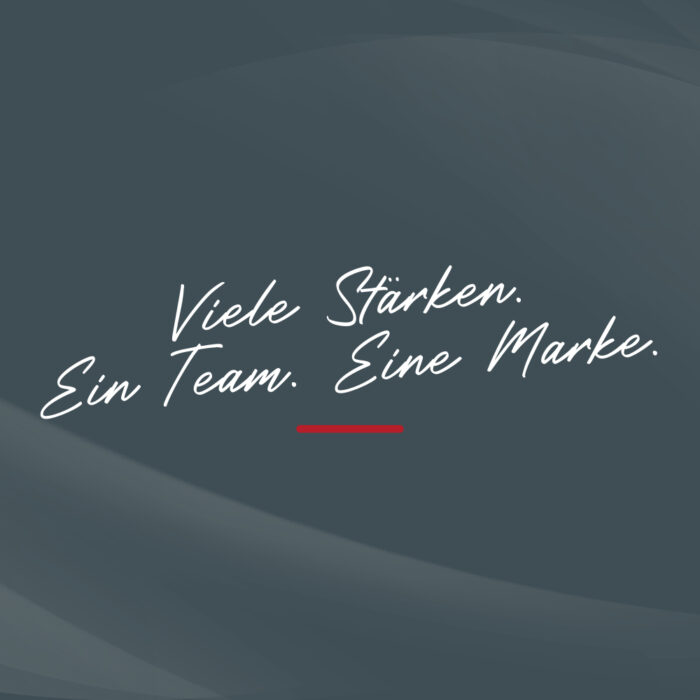Küchenabfälle recyclen mit der Bokashi-Methode
In jeder Küche fallen Bio-Abfälle an. Wer einen Garten hat, kann einen Komposthaufen anlegen. Stadtmenschen bleibt hier nur die Biotonne, doch bilden sich hier unangenehme Gerüche und Fruchtfliegen. Die...